Die Seite ist nicht konzipiert zur Nutzung im Querformat.
Sie haben Fragen?
Rufen Sie an!06108-824 6677
Mo-Fr von 10.00-17.00 Uhr
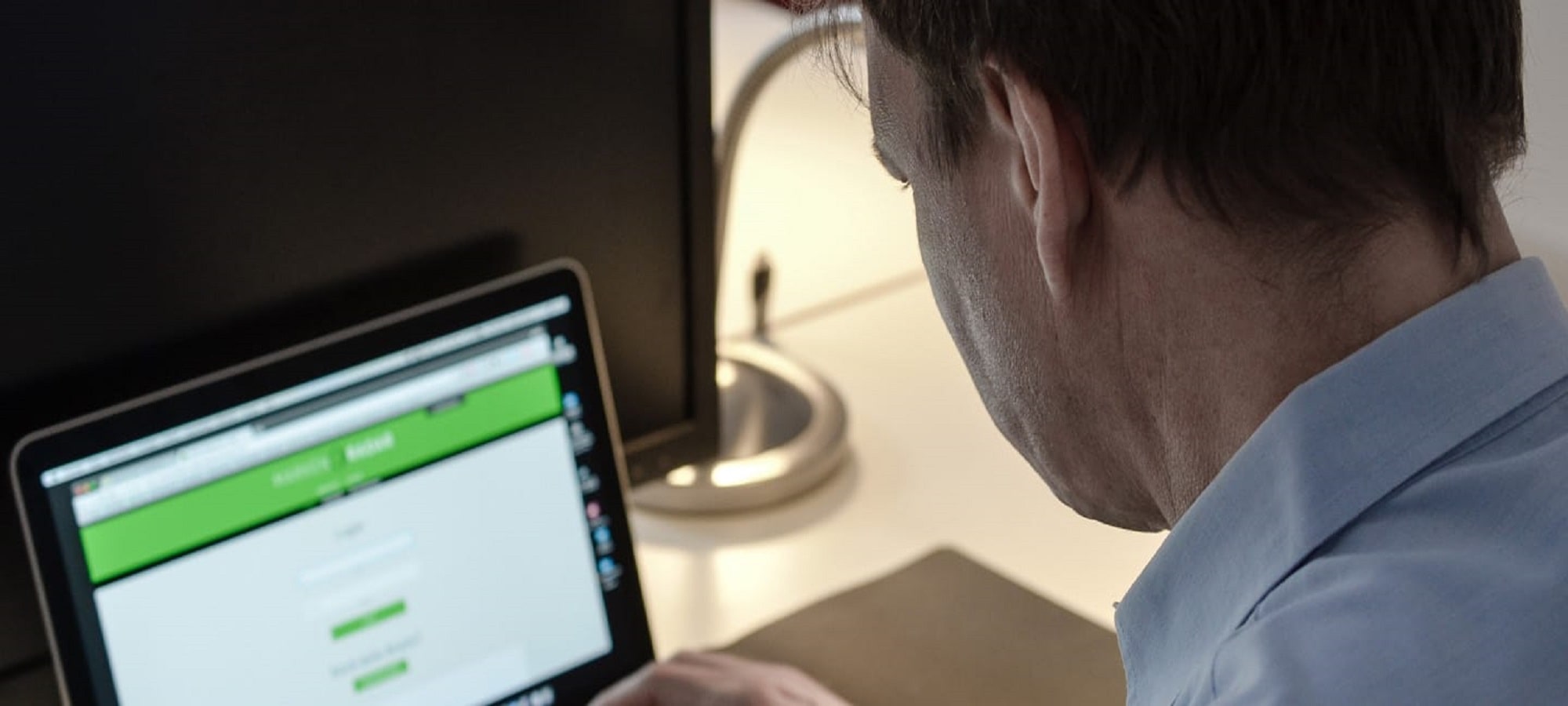
Markenwissen - einfach und kompetent
Das kleine Marken 1x1
Hier finden Sie nützliche Informationen, insbesondere wenn Sie Einsteiger in das Markenthema sind.Wussten Sie z.B. dass...
Markenrecherche
Sie möchten Ihr Geschäft schützen und planen daher eine Marke anzumelden?Wir erklären, warum Sie vorher eine Markenrecherche durchführen sollten.
Welche Risiken bestehen bei ungeprüften Anmeldungen?
Die neue Firma soll gegründet, ein Produkt oder eine Dienstleistung auf den Markt gebracht werden. Dazu benötigt man einen Namen, idealerweise als Marke eintragbar zur Absicherung gegenüber Nachahmern. Möglicherweise existieren aber bereits namensähnliche Marken oder Unternehmen - und mit jeder steigt die Gefahr von Abmahnungen nach der ungeprüften Anmeldung z.B. beim Handelsregister oder dem Markenamt. Das Geld für die Anmeldung wäre dann ebenso verloren wie für Corporate Design, Homepage oder Werbemittel. Die Anwaltskosten für die außergerichtliche Abmahnung betragen meist rund 1.500 EUR.
Mit Recherchen beim Markenamt oder dem Handelsregister minimieren Sie vor der Anmeldung Ihres Namens das Risiko von Abmahnungen. Ein Problem bei der Recherche beschreibt das deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) jedoch sehr treffend: „Beachten Sie bei Ihrer Recherche bitte, dass Sie im Register zwar Marken mit übereinstimmenden Merkmalen ihrer Markenanmeldung finden können, eine Ähnlichkeitssuche allerdings nicht möglich ist. Ein Widerspruch gegen Ihre Marke kann auch aus einer ähnlichen Marke erfolgen“.
Was gibt es für Recherchearten?
Das DPMA ist zuständig für die Anmeldung von Marken in Deutschland und bietet eine kostenlose Suchmöglichkeit nach bereits registrierten Marken. Die Suche nach Wortmarken und Wort-/Bildmarken findet allerdings nur identische Marken, man spricht hier auch von einer Identrecherche. So findet die Suche nach „Foxter“ im DPMA ausschließlich Marken, die ebenfalls genau so heißen.
Beim Einsatz professioneller Recherchedienste mit Ähnlichkeitssuche werden im gleichen Datenbestand zusätzlich ähnliche Marken gefunden, in unserem Beispiel VOXter, FOXTAR, foxxter, Fogstar und VOXTAR. Diese unterscheiden sich vom Ausgangswort zwar teils deutlich in der Schreibweise, allerdings ist bei der Einstufung der Verwechslungsgefahr und damit des Abmahnrisikos die klangliche Ähnlichkeit eines der entscheidenden Kriterien.
Anhand dieses Beispiels wird sehr anschaulich, dass bei einer reinen Identrecherche eine hohes Restrisiko einer Abmahnung besteht.
Somit spielt die Ähnlichkeitsrecherche eine wichtige Rolle bei der Identifizierung von Risiken und deren Minimierung.
Problematik der Ähnlichkeitsrecherche
Die Identrecherche findet gemäß Definition nur absolut gleiche Zeichenketten, meist unter Auslassung von Groß- und Kleinschreibung. So liefert die Identrecherche bei der Suche nach „Foxter“ nur identische Worte wie „foxter“ oder „FOXTER“. Somit ist bei der Identrecherche die Qualität der Ergebnisse vorherbestimmt und immer nachvollziehbar.
Bei der Ähnlichkeitsrecherche ist das leider nicht so einfach, denn der Begriff ist nicht definiert - jeder kann etwas anderes darunter verstehen. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten der Ähnlichkeitsrecherche, die wenig bis erheblichen Aufwand beim Rechercheanbieter verursachen. Eine einfache und beliebte Variante ist der Einsatz datenbankspezifischer Methoden wie Wildcards. Dabei wird nicht nur nach „foxter“ gesucht, sondern z.B. auch nach „fox*“. Somit werden alle Worte gefunden, die mit „fox“ anfangen, wie z.B. „foxnews“. Allerdings werden damit keine ähnlich klingenden Worte gefunden, die andere Buchstaben enthalten.
Dieses Problem gehen phonetische Algorithmen wie Kölner Phonetik, Soundex, Metaphone an. Diese liefern zum Teil sehr gute, aber auch sehr schlechte Ergebnisse. Denn einen sehr großen Einfluss kann die Sprache des gewählten Namens haben, so ist z.B. die Kölner Phonetik eher für die deutsche Sprache geeignet, hingegen Soundex und Metaphone wesentlich besser für englische Worte.
Wie sucht Marken-Radar?
Marken-Radar kombiniert Suchstrategien und Algorithmen und liefert so herausragende Ergebnisse zu identischen und ähnlichen Marken:
- Einsatz von KI-gestützten Suchalgorithmen:
- basierend auf erlernter Historie aus zurückliegenden Markenkonflikten
- manuell auf Ähnlichkeitserkennung trainierte Systeme
- Einsatz prozeduraler Suchalgorithmen:
- phonetische Algorithmen wie Kölner Phonetik, Soundex und Metaphone
- speziell auf Ähnlichkeitssuche optimierte Datenbanksuchen
- Ersetzungsstrategien und Homophones
- Abgleich mit mehreren Datenquellen
- Suche in den lokalen Registern des jeweiligen Landes, z.B. in Deutschland, UK oder Schweiz
- Suche in den übergeordneten, zuständigen Registern wie EU-IPO oder WIPO
Trotz der hohen Leistungsfähigkeit der Algorithmen erfolgt am Ende die manuelle Überprüfung und Optimierung durch Experten
Unsere Empfehlung zu Ihrer Recherche
Bei abmahnungsrelevanten Themen wie der Anmeldung einer Marke oder der Eintragung eines Unternehmens im Handelsregister sollten Sie zuvor eine passende Recherche durchführen. Denn ohne Recherche tragen Sie das maximale Risiko einer Abmahnung mit den entsprechenden Konsequenzen und Kosten. Eigene Recherchen sind wie oben beschrieben sehr schwierig durchzuführen und haben ein hohes Restrisiko.
Im Falle einer beispielhaften Markenrecherche für Deutschland stehen Ihnen verschiedene Dienstleister zur Verfügung. Diese haben zum Teil wiederum unterschiedliche Angebote für die Deutschlandrecherche, z.B. beworben mit Standard- und Premiumpaket.
Grundsätzlich gilt: je höher die Qualität der Recherche ist, desto minimaler ist Ihr Abmahnrisiko. Sie sollten sich daher informieren, welche Qualität Sie beim jeweiligen Angebot bekommen. Fragen in diesem Zusammenhang könnten sein: handelt es sich um eine Ident- oder Ähnlichkeitsrecherche? Welche Algorithmen werden für die Ähnlichkeitssuche eingesetzt?
Durch dieses Vorgehen minimieren Sie Ihr Risiko bei der Anmeldung und können diese mit gutem Gefühl durchführen.
Marken-Glossar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ähnlichkeitsrecherchen prüfen, ob die neue Marke bei den relevanten Markenämtern in ähnlicher Form für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen schon angemeldet wurde und entsprechender Markenschutz besteht. Ähnlichkeit bedeutet in diesem Fall optische oder klangliche Ähnlichkeit, z. B. adidas ist ähnlich abibas und adi dash. Bei der Ähnlichkeitsrecherche wird im Normalfall auch die Identität geprüft.
Professionelle Ähnlichkeitsrecherchen nutzen entsprechende Algorithmen, um schriftbildliche und phonetische Ähnlichkeiten mit älteren Schutzrechten zu ermitteln, und gehen damit über die Möglichkeiten der von den Markenämtern zur Verfügung gestellten Datenbanken hinaus.
Professionelle Ähnlichkeitsrecherchen nutzen entsprechende Algorithmen, um schriftbildliche und phonetische Ähnlichkeiten mit älteren Schutzrechten zu ermitteln, und gehen damit über die Möglichkeiten der von den Markenämtern zur Verfügung gestellten Datenbanken hinaus.
Im Markenblatt des DPMA werden alle neu eingetragenen Marken und Änderungen bei bereits bestehenden Marken elektronisch veröffentlicht. Einzelne Markenblätter können unter www.dpma.de aus dem Onlinedienst www.dpma.de/recherche/dpmaregister heruntergeladen werden.
Anmelder ist derjenige, für den ein Markenschutz beantragt wird (zukünftiger Markeninhaber). Anmelder kann eine natürliche oder juristische Person oder unter Umständen eine Personengesellschaft sein.
Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an dem die Unterlagen mit den Angaben beim Markenamt eingegangen sind. Ab diesem Zeitpunkt stehen dem Markeninhaber seine Rechte kraft seiner Marke zu, da mit Zuteilung eines Anmeldetages das angemeldete Zeichen als eingetragen gilt.
Das EUIPO mit Sitz in Alicante (Spanien) ist eine Agentur der Europäischen Union, die für die Eintragung der Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster zuständig ist. Das EUIPO ist nicht zuständig für andere Schutzrechte, z. B. Patente.
Bei formellen Mängeln wird dem Anmelder ein Beanstandungsbescheid mit genauer Benennung der Mängel zugesandt, um diese beseitigen zu können. Wird die Marke für nicht schutzfähig erachtet, wird vor einer Ablehnung der Markeneintragung ein Beanstandungsbescheid mit Erläuterungen der Schutzhindernisgründe versandt.
Bildmarken sind Bilder, Bildelemente oder Abbildungen (ohne Wortbestandteile). Somit sind alle visuellen Abbildungen möglich, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und können als Bildmarke beim DPMA angemeldet und geschützt werden.
Der englische Begriff Claim wird im Marketing, vor allem in der Werbung, häufig in derselben Bedeutung wie Slogan verwendet. Claim wird in Deutschland als Bezeichnung eines Werbeslogans benutzt; in England kennt man diesen als 'Endline' oder 'Strapline'. Er bezeichnet einen fest mit dem Unternehmens- oder Markennamen verbundenen Satz oder Teilsatz, der Bestandteil des Unternehmenslogos oder Markenzeichens sein kann. Mitunter gibt es auch 'Kampagnen-Claims', die nur für die Dauer einer Werbekampagne verwendet werden.
Ein Claim kann mehrere Funktionen haben: Er kann die Positionierung eines Leistungsangebotes oder einer Marke, ein zentrales 'Versprechen' oder einen Produktnutzen, eine Mission, eine Vision oder das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens oder der Marke kommunizieren.
Der Begriff leitet sich aus der früher in Nordamerika und Australien verwendeten Bezeichnung Claim für ein abgestecktes Grundstück ab.
Ein Claim kann mehrere Funktionen haben: Er kann die Positionierung eines Leistungsangebotes oder einer Marke, ein zentrales 'Versprechen' oder einen Produktnutzen, eine Mission, eine Vision oder das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens oder der Marke kommunizieren.
Der Begriff leitet sich aus der früher in Nordamerika und Australien verwendeten Bezeichnung Claim für ein abgestecktes Grundstück ab.
Der Begriff Corporate Design (CD) bzw. Unternehmens-Erscheinungsbild bezeichnet einen Teilbereich der Unternehmens-Identität (corporate identity) und beinhaltet das gesamte, einheitliche Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organisation. Dazu gehören vorrangig die Gestaltung der Kommunikationsmittel (Wortzeichen=Firmenschriftzug, Bildzeichen=Firmensignet, Wort-Bild-Zeichen=kombiniertes Firmensignet), aber auch die Gestaltung der Geschäftspapiere, Werbemittel, Verpackungen, Internetauftritte und die Produktgestaltung.
Ebenso kann das gemeinsame Design für die Berufskleidung in das voll integrierte Erscheinungsbild einbezogen werden. Der oft fälschlich synonym verwandte Begriff Logo bezeichnet jedoch nur ein Element des Corporate Design und ist daher ungeeignet, um das 'Konzept eines einheitlichen und umfassenden Firmen-Erscheinungsbilds' zu beschreiben.
Mit Corporate Design ist für ein Unternehmen ein geeignetes Zeichensystem festgelegt, das eingesetzt werden kann, um ein einheitliches und positives Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit sowie eine große Bekanntheit desselben zu erreichen (Wiedererkennungswert, Markenbekanntheit).
Ebenso kann das gemeinsame Design für die Berufskleidung in das voll integrierte Erscheinungsbild einbezogen werden. Der oft fälschlich synonym verwandte Begriff Logo bezeichnet jedoch nur ein Element des Corporate Design und ist daher ungeeignet, um das 'Konzept eines einheitlichen und umfassenden Firmen-Erscheinungsbilds' zu beschreiben.
Mit Corporate Design ist für ein Unternehmen ein geeignetes Zeichensystem festgelegt, das eingesetzt werden kann, um ein einheitliches und positives Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit sowie eine große Bekanntheit desselben zu erreichen (Wiedererkennungswert, Markenbekanntheit).
Corporate Identity oder kurz CI (von engl. corporation für 'Gesellschaft', 'Firma' und identity für 'Identität') ist die Gesamtheit der Merkmale, die ein Unternehmen kennzeichnen und es von anderen Unternehmen unterscheiden. Die Summe der Charakteristika eines Unternehmens repräsentiert die Corporate Identity. Das Konzept der CI beruht auf der Annahme, dass Unternehmen als soziale Systeme wie Personen wahrgenommen werden und ähnlich handeln können. Insofern wird dem Unternehmen eine quasi menschliche Persönlichkeit zugesprochen, beziehungsweise wird es als Aufgabe der Unternehmenskommunikation angesehen, dem Unternehmen zu einer solchen Identität zu verhelfen.
Die Identität einer Person ergibt sich für den Beobachter normalerweise aus der optischen Erscheinung sowie der Art und Weise zu sprechen und zu handeln. Betrachtet man ein Unternehmen als einen personalen, psychisch reifen Akteur, so lässt sich seine Identität mit einer Strategie konsistenten Handelns, Kommunizierens und visuellen Auftretens vermitteln. Ergeben diese komplementären Teile ein einheitliches Ganzes, entsteht eine stabile Wahrnehmung dieses Akteurs mit einem spezifischen Charakter, die Corporate Identity.
Die Identität einer Person ergibt sich für den Beobachter normalerweise aus der optischen Erscheinung sowie der Art und Weise zu sprechen und zu handeln. Betrachtet man ein Unternehmen als einen personalen, psychisch reifen Akteur, so lässt sich seine Identität mit einer Strategie konsistenten Handelns, Kommunizierens und visuellen Auftretens vermitteln. Ergeben diese komplementären Teile ein einheitliches Ganzes, entsteht eine stabile Wahrnehmung dieses Akteurs mit einem spezifischen Charakter, die Corporate Identity.
Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), bis 1998 Deutsches Patentamt, ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz mit Hauptsitz in München und Außenstellen in Jena, Berlin und Hauzenberg.
Im Jahr 2010 beschäftigte es 2735 Mitarbeiter, davon 827 Patentprüfer.
Das Patentamt ist die Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland und ist unter anderem für die Erteilung von Patenten, für die Eintragung von Gebrauchsmustern, Marken und Designs sowie für die Information der Öffentlichkeit über bestehende gewerbliche Schutzrechte zuständig. Anerkannte Kooperationspartner des DPMA in den Bundesländern sind die Patentinformationszentren, vereinigt in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Patentinformationszentren e.V.
Rechtsgrundlage ist § 26 des deutschen Patentgesetzes. Ursprünglich wurden Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen des Amtes vom Patentamt selber abgewickelt; seit 1961 ist hierfür das Bundespatentgericht zuständig.
Im Jahr 2010 beschäftigte es 2735 Mitarbeiter, davon 827 Patentprüfer.
Das Patentamt ist die Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland und ist unter anderem für die Erteilung von Patenten, für die Eintragung von Gebrauchsmustern, Marken und Designs sowie für die Information der Öffentlichkeit über bestehende gewerbliche Schutzrechte zuständig. Anerkannte Kooperationspartner des DPMA in den Bundesländern sind die Patentinformationszentren, vereinigt in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Patentinformationszentren e.V.
Rechtsgrundlage ist § 26 des deutschen Patentgesetzes. Ursprünglich wurden Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen des Amtes vom Patentamt selber abgewickelt; seit 1961 ist hierfür das Bundespatentgericht zuständig.
Unter Domainrecht werden eine Reihe verschiedener gesetzlicher Regelungen für die Vergabe von Internetdomänen verstanden. Es ist nicht in einem eigenen Gesetz kodifiziert, sondern hat sich durch Rechtsprechung in verschiedenen Rechtsbereichen herausgebildet.
Die Vergabe der Second-Level-Domains erfolgt grundsätzlich nach dem Prioritätsprinzip ('first come first serve' = 'wer zuerst kommt, mahlt zuerst'). Weder Internetdienstanbieter noch die zentralen Registrierungsstellen wie zum Beispiel DENIC für die Domänen .de überprüfen die rechtlichen Implikationen einer Domänenanmeldung. Demzufolge müssen die relevanten Rechtsgebiete von einem professionellen Domänenantragsteller vor der Anmeldung bei der Denic bzw. bei einem Provider geprüft werden. Dazu gehören das Namensrecht, das Markenrecht und das Wettbewerbsrecht.
Der Gebrauchswert eines schlüssigen Domainnamens führt häufig zu vorsätzlichem Missbrauch. Verbunden mit dem Domaingrabbing sind insbesondere Cybersquatting, Typosquatting und Markengrabbing.
Besondere Probleme kann die Frage aufwerfen, ob eine eingetragene und geschützte Marke die Eintragung und Nutzung einer Internet-Domain hindern kann. Generell gilt: Der berechtigte Markeninhaber kann vom unberechtigten Domainbetreiber Unterlassung der Nutzung und Übertragung der Domain verlangen. Allerdings nur, wenn die Domain für die von der Marke geschützten Waren und Dienstleistungen genutzt wird. Darüber hinausgehende Ansprüche sind möglich (zum Beispiel Schadensersatz), hängen aber vom Vorliegen von Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz beim unberechtigten Domainbetreiber ab, wobei im gewerblichen Rechtsschutz an die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt strenge Anforderungen gestellt werden.
Die Vergabe der Second-Level-Domains erfolgt grundsätzlich nach dem Prioritätsprinzip ('first come first serve' = 'wer zuerst kommt, mahlt zuerst'). Weder Internetdienstanbieter noch die zentralen Registrierungsstellen wie zum Beispiel DENIC für die Domänen .de überprüfen die rechtlichen Implikationen einer Domänenanmeldung. Demzufolge müssen die relevanten Rechtsgebiete von einem professionellen Domänenantragsteller vor der Anmeldung bei der Denic bzw. bei einem Provider geprüft werden. Dazu gehören das Namensrecht, das Markenrecht und das Wettbewerbsrecht.
Der Gebrauchswert eines schlüssigen Domainnamens führt häufig zu vorsätzlichem Missbrauch. Verbunden mit dem Domaingrabbing sind insbesondere Cybersquatting, Typosquatting und Markengrabbing.
Besondere Probleme kann die Frage aufwerfen, ob eine eingetragene und geschützte Marke die Eintragung und Nutzung einer Internet-Domain hindern kann. Generell gilt: Der berechtigte Markeninhaber kann vom unberechtigten Domainbetreiber Unterlassung der Nutzung und Übertragung der Domain verlangen. Allerdings nur, wenn die Domain für die von der Marke geschützten Waren und Dienstleistungen genutzt wird. Darüber hinausgehende Ansprüche sind möglich (zum Beispiel Schadensersatz), hängen aber vom Vorliegen von Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz beim unberechtigten Domainbetreiber ab, wobei im gewerblichen Rechtsschutz an die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt strenge Anforderungen gestellt werden.
Nachdem der Prüfer des zuständigen Markenamts die Markenanmeldung geprüft und keine formellen Mängel oder Schutzhindernisse festgestellt hat, trägt er die Marke in das nationale Markenregister ein. Der Eintragungstag ist nicht identisch mit dem Anmeldetag und dem Tag der Veröffentlichung der Marke.
Das EUIPO mit Sitz in Alicante (Spanien) ist eine Agentur der Europäischen Union, die für die Eintragung der Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster zuständig ist. Das EUIPO ist nicht zuständig für andere Schutzrechte, z. B. Patente.
Die Unionsmarke (englisch European Union trade mark; bis 23. März 2016 Gemeinschaftsmarke) ist ein Rechtsinstitut des gewerblichen Rechtsschutzes auf der Ebene des europäischen Sekundärrechtes. Sie dient wie die nationale Marke dazu, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von anderen zu unterscheiden. Mit Eintragung einer Unionsmarke erlangt der Rechtsinhaber eine Rechtsposition innerhalb des gesamten Binnenmarktes der Europäischen Union.
Die Unionsmarke bietet den Vorteil eines einheitlichen Schutzes in allen Ländern der Europäischen Union. Erforderlich hierfür ist nur ein einziges Eintragungsverfahren beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO).
Die Unionsmarke bietet den Vorteil eines einheitlichen Schutzes in allen Ländern der Europäischen Union. Erforderlich hierfür ist nur ein einziges Eintragungsverfahren beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO).
Als Freihaltebedürfnis wird im Markenrecht (in Deutschland unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) das berechtigte Interesse von Wettbewerbern eines Unternehmens bezeichnet, beschreibende Angaben ihrer Waren oder Dienstleistungen frei benutzen zu können.
Das Freihaltebedürfnis gehört zu den absoluten Schutzhindernissen im Markenrecht. Demnach kann eine Marke, die ausschließlich aus Zeichen besteht, die ein Wettbewerber zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes oder der Herkunft der Ware oder Dienstleistung benötigt, nicht als Marke eingetragen werden, da die Wettbewerber an diesen Zeichen ein berechtigtes Interesse zur freien Verwendung haben. Jedoch bezieht sich ein Freihaltebedürfnis stets auf spezifische Waren- oder Dienstleistungen und gilt nicht generell, so dass auch innerhalb einer Waren- oder Dienstleistungsklasse durch Beschränkungen dieser die Eintragung eines Kennzeichens möglich werden kann. Möglich ist es allerdings auch, dass ein Zeichen aufgrund Verkehrsdurchsetzung Markenschutz genießt, obwohl ein Freihaltebedürfnis für das Zeichen bestehen würde.
Zu trennen sind diese 'beschreibenden Angaben', die von Wettbewerbern benötigt werden könnten, vom 'beschreibenden Begriffsinhalt' einer Marke, der bei der Prüfung der Unterscheidungskraft zum Tragen kommt. Beim 'beschreibenden Begriffsinhalt' wird auf die angesprochenen Verkehrskreise, also nicht auf die Wettbewerber, sondern auf die 'Verbraucher' abgestellt.
Beispiele:
Diesel kann nicht als Marke für Kraftstoffe eingetragen werden, da andere Kraftstoffhersteller oder Vertreiber diesen Begriff zur Beschreibung der Art des Kraftstoffs benötigen. Dagegen kann Diesel für Bekleidungswaren durchaus eingetragen werden, da nicht anzunehmen ist, dass ein Bekleidungshersteller diesen Begriff zur Beschreibung eines Bekleidungsstückes benötigt.
Flüssig kann ebenfalls nicht für Kraftstoffe eingetragen werden, da dies eine Beschreibung der Beschaffenheit eines Kraftstoffs sein kann, die von einem Wettbewerber benötigt werden könnte.
WM 2006 für verschiedene Waren und Dienstleistungen ist sehr umstritten. Einerseits könnte der Hinweis auf eine im Jahre 2006 stattfindende Weltmeisterschaft eine Bestimmungsangabe darstellen, andererseits stellt sich die Frage, ob beispielsweise kleine Plastikfiguren o. ä. für eine Fußball-Weltmeisterschaft bestimmt sein können.
Das Freihaltebedürfnis gehört zu den absoluten Schutzhindernissen im Markenrecht. Demnach kann eine Marke, die ausschließlich aus Zeichen besteht, die ein Wettbewerber zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes oder der Herkunft der Ware oder Dienstleistung benötigt, nicht als Marke eingetragen werden, da die Wettbewerber an diesen Zeichen ein berechtigtes Interesse zur freien Verwendung haben. Jedoch bezieht sich ein Freihaltebedürfnis stets auf spezifische Waren- oder Dienstleistungen und gilt nicht generell, so dass auch innerhalb einer Waren- oder Dienstleistungsklasse durch Beschränkungen dieser die Eintragung eines Kennzeichens möglich werden kann. Möglich ist es allerdings auch, dass ein Zeichen aufgrund Verkehrsdurchsetzung Markenschutz genießt, obwohl ein Freihaltebedürfnis für das Zeichen bestehen würde.
Zu trennen sind diese 'beschreibenden Angaben', die von Wettbewerbern benötigt werden könnten, vom 'beschreibenden Begriffsinhalt' einer Marke, der bei der Prüfung der Unterscheidungskraft zum Tragen kommt. Beim 'beschreibenden Begriffsinhalt' wird auf die angesprochenen Verkehrskreise, also nicht auf die Wettbewerber, sondern auf die 'Verbraucher' abgestellt.
Beispiele:
Diesel kann nicht als Marke für Kraftstoffe eingetragen werden, da andere Kraftstoffhersteller oder Vertreiber diesen Begriff zur Beschreibung der Art des Kraftstoffs benötigen. Dagegen kann Diesel für Bekleidungswaren durchaus eingetragen werden, da nicht anzunehmen ist, dass ein Bekleidungshersteller diesen Begriff zur Beschreibung eines Bekleidungsstückes benötigt.
Flüssig kann ebenfalls nicht für Kraftstoffe eingetragen werden, da dies eine Beschreibung der Beschaffenheit eines Kraftstoffs sein kann, die von einem Wettbewerber benötigt werden könnte.
WM 2006 für verschiedene Waren und Dienstleistungen ist sehr umstritten. Einerseits könnte der Hinweis auf eine im Jahre 2006 stattfindende Weltmeisterschaft eine Bestimmungsangabe darstellen, andererseits stellt sich die Frage, ob beispielsweise kleine Plastikfiguren o. ä. für eine Fußball-Weltmeisterschaft bestimmt sein können.
Ein Homophon bzw. Homofon (griechisch 'zusammentönend, gleichlautend') ist ein Wort, das die gleiche Aussprache wie ein anderes mit unterschiedlicher Bedeutung hat, z.B. Lid und Lied oder Rad und Rat. Der Begriff wird unterschiedlich definiert, so werden manchmal auch Wörter mit verschiedenen Genera einbezogen wie z. B. die Leiter (Gerät) / der Leiter (Funktion).
Bei gleicher Schreibweise sind sie zugleich Homographen. Wörter mit gleicher Schreibweise nicht zu den Homophonen.
Professionelle Ähnlichkeitsrecherchen finden im Gegensatz zu Identrecherchen Homophones, z.B. Cola und Kola.
Bei gleicher Schreibweise sind sie zugleich Homographen. Wörter mit gleicher Schreibweise nicht zu den Homophonen.
Professionelle Ähnlichkeitsrecherchen finden im Gegensatz zu Identrecherchen Homophones, z.B. Cola und Kola.
Die Identrecherche sucht nach absolut gleichen Wortmarken bzw. Wort-/Bildmarken. Diese findet daher also nur identische Marken. So findet die Suche nach 'Foxter' im DPMA ausschließlich Marken, die ebenfalls genau so heißen, nicht aber 'Foxder' oder 'Foxxter'
Das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (kurz: Madrider Markenabkommen oder MMA) von 1891 ist ein Abkommen zwischen einer Vielzahl von Ländern, durch welche nationale Marken eines Verbandsstaates auch in den anderen Verbandsstaaten Schutz genießen können und somit eine international registrierte (IR) Marke geschaffen werden kann.
Um das MMA nutzen zu können, muss folgendes Prozedere durchlaufen werden:
1. Erfolgreiche Eintragung einer nationalen Marke beim nationalen Markenamt wie dem DPMA, Basismarke oder Ursprungsmarke genannt.
2. Alternativ genügt seit kurzem auch lediglich die Anmeldung einer nationalen Marke beim nationalen Markenamt.
3. Antrag zum Beispiel nach § 108 MarkenG beim nationalen Markenamt auf internationale Registrierung mit Nennung der Erstreckungsländer
4. Weiterleitung des Antrages durch das nationale Markenamt an die WIPO.
5. Veröffentlichung der Marke durch die WIPO ohne Prüfung im Markenblatt Les Marques internationales.
6. Weiterleitung des Anmeldeantrages durch die WIPO an die benannten nationalen Markenämter.
7. Prüfung der benannten nationalen Markenämter, ob relative oder absolute Schutzhindernisse vorliegen.
8. Sofern keine Hindernisse vorliegen genießt die IR-Marke den gleichen Schutz wie eine nationale Marke in einem Erstreckungsland.
Um das MMA nutzen zu können, muss folgendes Prozedere durchlaufen werden:
1. Erfolgreiche Eintragung einer nationalen Marke beim nationalen Markenamt wie dem DPMA, Basismarke oder Ursprungsmarke genannt.
2. Alternativ genügt seit kurzem auch lediglich die Anmeldung einer nationalen Marke beim nationalen Markenamt.
3. Antrag zum Beispiel nach § 108 MarkenG beim nationalen Markenamt auf internationale Registrierung mit Nennung der Erstreckungsländer
4. Weiterleitung des Antrages durch das nationale Markenamt an die WIPO.
5. Veröffentlichung der Marke durch die WIPO ohne Prüfung im Markenblatt Les Marques internationales.
6. Weiterleitung des Anmeldeantrages durch die WIPO an die benannten nationalen Markenämter.
7. Prüfung der benannten nationalen Markenämter, ob relative oder absolute Schutzhindernisse vorliegen.
8. Sofern keine Hindernisse vorliegen genießt die IR-Marke den gleichen Schutz wie eine nationale Marke in einem Erstreckungsland.
Eine nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (kurz: Madrider Markenabkommen oder MMA) international registrierte Marke. Dabei ist die Marke in den Ländern registriert, die bei der Anmeldung benannt wurden.
Die Ergebnisse einer Markenüberwachung nennt man Kollisionsbericht. Dieser enthält in der Regel den Namen der Kollisionsmarke, Darstellung der Marke, Register, Waren- und Dienstleistungsklassen, Inhaber und Vertreter der Kollisionsmarke sowie Informationen zu den Widerspruchsfristen.
Der Kollisionsbericht ist für den Markeninhaber oder seinen Anwalt dann die Entscheidungsbasis, ob er gegen die Kollisionsmarke vorgehen wird und welche Maßnahmen er ergreift.
Der Kollisionsbericht ist für den Markeninhaber oder seinen Anwalt dann die Entscheidungsbasis, ob er gegen die Kollisionsmarke vorgehen wird und welche Maßnahmen er ergreift.
Eine Markenüberwachung beinhaltet die systematische und permanente Beobachtung der relevanten Markenregister nach möglichen Markenkollisionen mit anderen Marken, Kollisionsmarken genannt. Das sind identische und optisch, akustisch oder konzeptionell ähnliche Marken zur überwachten Marke.
Ein Logo ist ein grafisches Zeichen (Signet), das ein bestimmtes Subjekt repräsentiert, dies kann ein Unternehmen, eine Organisation, eine Privatperson oder ein Produkt sein. Es kann als reine Bildmarke, Wortmarke oder Wort-Bild-Marke gestaltet sein und ist der wesentliche Bestandteil des visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) sowie Träger der Identität (Corporate Identity) des Rechteinhabers.
Eine Marke oder ein Markenzeichen wurde mit der Markenrechtsreform 1995 offiziell in Deutschland eingeführt. Das Warenzeichen als traditionelle Bezeichnung war mit dem notwendig gewordenen Schutz von Dienstleistungen als Produkt nicht mehr umfassend genug aussagekräftig geworden. Nun erweitert ein besonderes, rechtlich geschütztes Zeichen, das vor allem dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden, den Kanon der Immaterialgüterrechte.
Eine Marke kann aber auch dazu verwendet werden, um ein ganzes Unternehmen oder das Leistungsangebot eines ganzen geographischen Orts (Land, Region, Stadt) eindeutig zu kennzeichnen und von konkurrierenden Unternehmen oder Angeboten abzugrenzen.
Marken können eine einzelne Darstellung oder eine Kombination von einem oder mehrerer Buchstaben, Zeichen, Wörter, Namen, Slogans, Logos, Symbolen, Bildern, Klängen, Klangfolgen bzw. von Erscheinungsformen und Mustern von und für Produkte verschiedener Art sein.
Markenrechte sind ähnlich wie Patente und Urheberrechte immaterielle Monopolrechte, oft auch als geistiges Eigentum bezeichnet.
Der juristische Begriff der Marke unterscheidet sich von dem der Marke im Marketing. Dort umfasst er nicht nur ein geschütztes Zeichen, sondern auch die Gesamtheit der Eigenschaften eines Wirtschaftsgutes, das mit einem Markennamen in Verbindung steht.
Eine Marke kann aber auch dazu verwendet werden, um ein ganzes Unternehmen oder das Leistungsangebot eines ganzen geographischen Orts (Land, Region, Stadt) eindeutig zu kennzeichnen und von konkurrierenden Unternehmen oder Angeboten abzugrenzen.
Marken können eine einzelne Darstellung oder eine Kombination von einem oder mehrerer Buchstaben, Zeichen, Wörter, Namen, Slogans, Logos, Symbolen, Bildern, Klängen, Klangfolgen bzw. von Erscheinungsformen und Mustern von und für Produkte verschiedener Art sein.
Markenrechte sind ähnlich wie Patente und Urheberrechte immaterielle Monopolrechte, oft auch als geistiges Eigentum bezeichnet.
Der juristische Begriff der Marke unterscheidet sich von dem der Marke im Marketing. Dort umfasst er nicht nur ein geschütztes Zeichen, sondern auch die Gesamtheit der Eigenschaften eines Wirtschaftsgutes, das mit einem Markennamen in Verbindung steht.
Markenrechte können auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene bestehen. Man unterscheidet zwischen Wortmarken (der geschriebene Name) und Bildmarken, beispielsweise die grafische Darstellung eines Logos. Dementsprechend gibt es nationale Marken, EU-Marken und IR-Marken. Um Markenrechte wirksam abzusichern, ist es im ersten Schritt erforderlich, den voraussichtlichen territorialen Wirkungsbereich des künftigen Markeninhabers festzustellen. Dabei kann es schon allein im Hinblick auf Aktivitäten im weltweit zugänglichen Internet sinnvoll sein, den Markenschutz über das eigene Land hinaus zu erstrecken.
Im zweiten Schritt ist durch eine Markenrecherche in den einschlägigen Markenregistern der in Betracht kommenden Länder festzustellen, ob bereits ältere Rechte in dem betreffenden Land existieren, die einen neuen Markenschutz ausschließen.
Falls dies nicht der Fall ist, muss im dritten Schritt die Marke auf die speziellen Bedürfnisse des künftigen Markeninhabers zugeschnitten werden. Hierbei geht es sowohl um die Auswahl und Gestaltung der Marke selbst als auch um deren korrekte Klassifizierung anhand der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen nach Nizzaer Klassifikation, damit der Markenanmelder in seinen künftigen Aktivitäten mit der Marke optimal abgesichert ist.
Schließlich kann im letzten Schritt für die so ausgewählte Marke eine Markenanmeldung ausgearbeitet und prioritätswahrend bei dem betreffenden Markenamt hinterlegt werden. Nun muss noch die dreimonatige Widerspruchsfrist abgewartet werden, bevor die Marke formell bestandskräftig wird und im Geschäftsverkehr verwendet werden kann – das ®-Zeichen darf nun dem Markennamen angefügt werden. Mit erfolgreichem Abschluss des Registrierungsverfahrens erhält der Anmelder eine Markenurkunde.
Im zweiten Schritt ist durch eine Markenrecherche in den einschlägigen Markenregistern der in Betracht kommenden Länder festzustellen, ob bereits ältere Rechte in dem betreffenden Land existieren, die einen neuen Markenschutz ausschließen.
Falls dies nicht der Fall ist, muss im dritten Schritt die Marke auf die speziellen Bedürfnisse des künftigen Markeninhabers zugeschnitten werden. Hierbei geht es sowohl um die Auswahl und Gestaltung der Marke selbst als auch um deren korrekte Klassifizierung anhand der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen nach Nizzaer Klassifikation, damit der Markenanmelder in seinen künftigen Aktivitäten mit der Marke optimal abgesichert ist.
Schließlich kann im letzten Schritt für die so ausgewählte Marke eine Markenanmeldung ausgearbeitet und prioritätswahrend bei dem betreffenden Markenamt hinterlegt werden. Nun muss noch die dreimonatige Widerspruchsfrist abgewartet werden, bevor die Marke formell bestandskräftig wird und im Geschäftsverkehr verwendet werden kann – das ®-Zeichen darf nun dem Markennamen angefügt werden. Mit erfolgreichem Abschluss des Registrierungsverfahrens erhält der Anmelder eine Markenurkunde.
Unter Markenbekanntheit versteht man einen Wert, der durch die Befragung von Zielgruppen ermittelt wird. Der Wert gibt an, wie viel Prozent der Befragten sich in den Tests an eine bestimmte Marke erinnern konnten.
Es wird untersucht, unter welchen Bedingungen sich die Testpersonen an die Marke erinnern, und ob sie die Marke beim Wiedererkennen der richtigen Produktkategorie zuordnen konnten.
Markenbekanntheit ist Voraussetzung dafür, dass der Konsument der Marke ein Image zuordnen und Assoziationen mit ihr verknüpfen kann. Bei Kaufentscheidungsprozessen werden außerdem vorzugsweise Marken berücksichtigt, die bereits bekannt sind.
Es wird untersucht, unter welchen Bedingungen sich die Testpersonen an die Marke erinnern, und ob sie die Marke beim Wiedererkennen der richtigen Produktkategorie zuordnen konnten.
Markenbekanntheit ist Voraussetzung dafür, dass der Konsument der Marke ein Image zuordnen und Assoziationen mit ihr verknüpfen kann. Bei Kaufentscheidungsprozessen werden außerdem vorzugsweise Marken berücksichtigt, die bereits bekannt sind.
Eine Markenüberwachung beinhaltet die systematische und permanente Beobachtung der relevanten Markenregister nach möglichen Markenkollisionen mit anderen Marken, Kollisionsmarken genannt. Das sind identische und optisch, akustisch oder konzeptionell ähnliche Marken zur überwachten Marke.
Mit einer Markenlizenz gestattet der Markeninhaber – meist gegen Entgelt – einer anderen Person oder einem anderen Unternehmen, die Marke zu nutzen.
Als Produktpiraterie, Produktfälschung oder Markenpiraterie wird das Geschäft mit Nachahmer-Waren bezeichnet, die mit dem Ziel hergestellt werden, einer Original-Ware zum Verwechseln ähnlich zu sein. Dabei werden Markenrechte oder wettbewerbsrechtliche Vorschriften verletzt. Häufig geht die Produktpiraterie dabei auch mit Verletzungen von Urheberrechten, eingetragenen Designs (früher: Geschmacksmustern), Gebrauchsmustern, Patenten und sonstigen Rechten des Geistigen Eigentums und Gewerblichen Rechtsschutzes einher.
Gefälscht wird in allen Bereichen: Software, Uhren, Bekleidung, Medikamente, Autoteile bis hin zu kompletten Kraftfahrzeugen.
Auch Ersatzteile von Maschinen und Investitionsgütern – sogar von Flugzeugen – werden kopiert.
Maßnahmen gegen Produktpiraterie und Fälschungen beschreiben Produktschutz und Produktsicherung.
Gefälscht wird in allen Bereichen: Software, Uhren, Bekleidung, Medikamente, Autoteile bis hin zu kompletten Kraftfahrzeugen.
Auch Ersatzteile von Maschinen und Investitionsgütern – sogar von Flugzeugen – werden kopiert.
Maßnahmen gegen Produktpiraterie und Fälschungen beschreiben Produktschutz und Produktsicherung.
Das Markenrecht der Bundesrepublik Deutschland ist ein Bestandteil des Kennzeichenrechtes, das Bezeichnungen von Produkten im geschäftlichen Verkehr schützt. Das Kennzeichenrecht gehört seinerseits zum gewerblichen Rechtsschutz. Markenrechte können auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene bestehen.
Das Markenregister im Beispiel für Deutschland ist ein unter www.dpma.de/recherche/dpmaregister öffentlich zugängliches Register, das beim DPMA geführt wird. Es enthält unter anderem folgende Angaben: Anmeldetag und Beginn der Schutzdauer einer Marke, Markendarstellung, für welche Waren und Dienstleistungen die jeweilige Marke eingetragen wurde, Markennummer, Anmelder und Inhaber der Marke, Vertreter des Markeninhabers, ob die Marke aufgrund bestehender Verkehrsgeltung eingetragen wurde bzw. Hinweise, ob gegen diese Marke ein Widerspruchs oder Löschungsverfahren anhängig ist.
In erster Linie entsteht der Markenschutz durch die Eintragung der Marke. In vielen Staaten wie Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein regeln dies nationale Patentämter. Im Einzelnen sind dies das Patent- und Markenamt in München, das Patentamt in Wien, das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum in Bern und das Amt für Volkswirtschaft (AVW), Fachbereich Immaterialgüterrechte in Vaduz. Nahezu sämtliche Staaten der Welt verfügen über ähnliche Einrichtungen und haben ähnliche Vorschriften, die die Eintragung von Marken vorsehen. Diese nationalen Marken gelten jeweils nur für ein Land. Internationale oder europäische Marken sind gemäß der Pariser Übereinkunft, und dem Madrider Abkommen beim Europäischen Patentamt einzutragen.
Es gibt unterschiedliche Wege zur Entstehung des Markenschutzes. Eine Marke kann auch durch Benutzung entstehen, sofern die Marke Verkehrsgeltung erworben hat (Benutzungsmarke, § 4 Nr. 2 MarkenG). Dies ist dann der Fall, wenn ein erheblicher Teil der Abnehmer der von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen diese Marke einem Unternehmen zuordnen.
Darüber hinaus kann auch durch eine notorische Bekanntheit der Marke Markenschutz entstehen (Notorietätsmarke, § 4 Nr. 3 MarkenG).
Den überwiegenden Teil der Marken in Deutschland stellen die Registermarken (Registermarke, § 4 Nr. 1 MarkenG) dar, da es eines erheblichen Aufwandes bedarf, Verkehrsgeltung oder gar notorische Bekanntheit für eine Marke zu erzielen. In der Regel sind Benutzungsmarken nur bei Waren oder Dienstleistungen anzutreffen, die ein sehr kleines, spezielles Publikum ansprechen, beispielsweise im Spezialmaschinenbau. Die Registermarke, auf die im Folgenden eingegangen wird, ist ein förmliches, absolutes Immaterialgüterrecht.
Es gibt unterschiedliche Wege zur Entstehung des Markenschutzes. Eine Marke kann auch durch Benutzung entstehen, sofern die Marke Verkehrsgeltung erworben hat (Benutzungsmarke, § 4 Nr. 2 MarkenG). Dies ist dann der Fall, wenn ein erheblicher Teil der Abnehmer der von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen diese Marke einem Unternehmen zuordnen.
Darüber hinaus kann auch durch eine notorische Bekanntheit der Marke Markenschutz entstehen (Notorietätsmarke, § 4 Nr. 3 MarkenG).
Den überwiegenden Teil der Marken in Deutschland stellen die Registermarken (Registermarke, § 4 Nr. 1 MarkenG) dar, da es eines erheblichen Aufwandes bedarf, Verkehrsgeltung oder gar notorische Bekanntheit für eine Marke zu erzielen. In der Regel sind Benutzungsmarken nur bei Waren oder Dienstleistungen anzutreffen, die ein sehr kleines, spezielles Publikum ansprechen, beispielsweise im Spezialmaschinenbau. Die Registermarke, auf die im Folgenden eingegangen wird, ist ein förmliches, absolutes Immaterialgüterrecht.
Eine Markenüberwachung ist die systematische und permanente Beobachtung der relevanten Markenregister nach möglichen Kollisionsmarken. Sie ist nach erfolgreicher Eintragung empfehlenswert, um die Marke gegen mögliche Gefahren verteidigen zu können.
Seit dem Jahr 2000 wurden allein in Deutschland jedes Jahr im Schnitt knapp 70.000 neue Marken beim DPMA angemeldet. Somit ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass neu angemeldete Marken gegen Schutzrechte anderer bereits registrierter und damit prioritätsälterer Marken verstoßen. Hinzukommt, dass das Amt nicht prüft, ob es bereits gleiche oder ähnliche Marken anderer Markeninhaber in gleichen oder ähnlichen Waren- und Dienstleistungsklassen gibt.
Diese bewusste oder unbewusste Identität oder Ähnlichkeit zu bestehenden Marken führt zu Bedrohungen wie Nachahmung, Markenpiraterie, Verballhornung, Verunglimpfung, Bootlegging, Verwässerung oder Verwechslung. Der Markeninhaber der bestehenden, älteren Marke erfährt von der Bedrohung im Regelfall erst dann, wenn es zu spät ist, das heißt, wenn sich die neue Marke am Markt auf Kosten der alten Marke positioniert und etabliert hat. Die Verteidigung der Rechte der alten Marke ist dann gegebenenfalls schwierig und kostenintensiv.
Um der Schwächung der eigenen Marke frühzeitig begegnen zu können, bieten spezialisierte Dienstleistungsunternehmen sogenannte Markenüberwachungen an. Deren Gegenstand ist die Marke in ihrer registrierten Form. Bei Wortmarken sind dies der oder die Wortbestandteil(e) oder Silben, bei Wort-Bild-Marken entsprechend die Wort- und Bildbestandteile und bei Bildmarken die Grafik oder die bildliche Darstellung. Dies gilt analog für Farb- und Hörmarken. Die Marke wird üblicherweise in allen Markenregistern, in denen sie angemeldet ist und in allen Waren- und Dienstleistungsklassen überwacht.
Die Überwachungsunternehmen kontrollieren in regelmäßigen Abständen die entsprechenden Markenneuanmeldungen in den relevanten Registern und Klassen auf sogenannte Kollisionen. Das heißt, es werden systematisch zur Überwachungsmarke identische und optisch, akustisch oder konzeptionell ähnliche Marken ermittelt.
Die Überwachungsergebnisse bekommt der Auftraggeber (Unternehmen, Anwalt oder Kanzlei) in Form sogenannter Kollisionsberichte mitgeteilt. Diese enthalten in der Regel den Namen der Kollisionsmarke, Darstellung der Marke, Register, Waren- und Dienstleistungsklassen, Inhaber und Vertreter der Kollisionsmarke sowie Informationenzu den Widerspruchsfristen.
Der Kollisionsbericht ist für den Markeninhaber oder seinen Anwalt dann die Entscheidungsbasis, ob er gegen die Kollisionsmarke vorgehen wird und welche Maßnahmen er ergreift.
Seit dem Jahr 2000 wurden allein in Deutschland jedes Jahr im Schnitt knapp 70.000 neue Marken beim DPMA angemeldet. Somit ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass neu angemeldete Marken gegen Schutzrechte anderer bereits registrierter und damit prioritätsälterer Marken verstoßen. Hinzukommt, dass das Amt nicht prüft, ob es bereits gleiche oder ähnliche Marken anderer Markeninhaber in gleichen oder ähnlichen Waren- und Dienstleistungsklassen gibt.
Diese bewusste oder unbewusste Identität oder Ähnlichkeit zu bestehenden Marken führt zu Bedrohungen wie Nachahmung, Markenpiraterie, Verballhornung, Verunglimpfung, Bootlegging, Verwässerung oder Verwechslung. Der Markeninhaber der bestehenden, älteren Marke erfährt von der Bedrohung im Regelfall erst dann, wenn es zu spät ist, das heißt, wenn sich die neue Marke am Markt auf Kosten der alten Marke positioniert und etabliert hat. Die Verteidigung der Rechte der alten Marke ist dann gegebenenfalls schwierig und kostenintensiv.
Um der Schwächung der eigenen Marke frühzeitig begegnen zu können, bieten spezialisierte Dienstleistungsunternehmen sogenannte Markenüberwachungen an. Deren Gegenstand ist die Marke in ihrer registrierten Form. Bei Wortmarken sind dies der oder die Wortbestandteil(e) oder Silben, bei Wort-Bild-Marken entsprechend die Wort- und Bildbestandteile und bei Bildmarken die Grafik oder die bildliche Darstellung. Dies gilt analog für Farb- und Hörmarken. Die Marke wird üblicherweise in allen Markenregistern, in denen sie angemeldet ist und in allen Waren- und Dienstleistungsklassen überwacht.
Die Überwachungsunternehmen kontrollieren in regelmäßigen Abständen die entsprechenden Markenneuanmeldungen in den relevanten Registern und Klassen auf sogenannte Kollisionen. Das heißt, es werden systematisch zur Überwachungsmarke identische und optisch, akustisch oder konzeptionell ähnliche Marken ermittelt.
Die Überwachungsergebnisse bekommt der Auftraggeber (Unternehmen, Anwalt oder Kanzlei) in Form sogenannter Kollisionsberichte mitgeteilt. Diese enthalten in der Regel den Namen der Kollisionsmarke, Darstellung der Marke, Register, Waren- und Dienstleistungsklassen, Inhaber und Vertreter der Kollisionsmarke sowie Informationenzu den Widerspruchsfristen.
Der Kollisionsbericht ist für den Markeninhaber oder seinen Anwalt dann die Entscheidungsbasis, ob er gegen die Kollisionsmarke vorgehen wird und welche Maßnahmen er ergreift.
Der Begriff Markenwert (auch Brand Equity oder Brand Value) bezeichnet den monetären Wert einer Marke. Einfach ausgedrückt besteht der Wert eines Unternehmens nicht nur aus dem Umsatz, den Firmenimmobilien, dem Mitarbeiter-Potenzial und Patenten, sondern auch aus dem nicht-materiellen Wert seiner Marke bzw. seiner Marken. Allein durch die Markierung und die mit dem Markenzeichen verbundenen, positiven Assoziationen beim Konsumenten ist es einem Unternehmen möglich, mehr Geld für das eigene Produkt zu bekommen, als dies etwa Gattungsmarken möglich ist. Daher hat das Markenzeichen einen eigenen, immateriellen Wert.
In verschiedenen Ländern (wie zum Beispiel in Großbritannien) ist bereits heute eine Bilanzierung der Marken eines Unternehmens möglich. Dies ist auch mit ein Grund, warum viele Unternehmen höhere Börsenwerte als Vermögen haben. Für die Bestimmung des Markenwertes existieren eine Reihe von Modellen, denen gemeinsam ist, dass sie ein jeweils eigenes Bewertungsschema zugrunde legen müssen, es somit keine objektive Setzung für den Begriff des Markenwertes gibt.
Die Ansätze sind komplex und können verschiedene Ziele haben. Zum einen kann die Markenwertberechnung beim Kauf und Verkauf von Marken oder Unternehmen zu Hilfe genommen werden, um einen realistischen Kaufpreis zu ermitteln. Auch bei der Lizenzierung von Marken zur Ermittlung von Lizenzsätzen ist eine Markenwertanalyse sinnvoll, um eine Grundlage für Preisverhandlungen zu haben.
Die Analyse eines Markenwertes und seiner Schwankungen kann auch wichtig für die strategische Markenführung sein.
In verschiedenen Ländern (wie zum Beispiel in Großbritannien) ist bereits heute eine Bilanzierung der Marken eines Unternehmens möglich. Dies ist auch mit ein Grund, warum viele Unternehmen höhere Börsenwerte als Vermögen haben. Für die Bestimmung des Markenwertes existieren eine Reihe von Modellen, denen gemeinsam ist, dass sie ein jeweils eigenes Bewertungsschema zugrunde legen müssen, es somit keine objektive Setzung für den Begriff des Markenwertes gibt.
Die Ansätze sind komplex und können verschiedene Ziele haben. Zum einen kann die Markenwertberechnung beim Kauf und Verkauf von Marken oder Unternehmen zu Hilfe genommen werden, um einen realistischen Kaufpreis zu ermitteln. Auch bei der Lizenzierung von Marken zur Ermittlung von Lizenzsätzen ist eine Markenwertanalyse sinnvoll, um eine Grundlage für Preisverhandlungen zu haben.
Die Analyse eines Markenwertes und seiner Schwankungen kann auch wichtig für die strategische Markenführung sein.
Wird eine Marke nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung ins Register tatsächlich benutzt, kann sie gelöscht werden. Dieser Benutzungszwang bedeutet, dass Markeninhaber ihre Marke ernsthaft im Inland zur Kennzeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsleben benutzen müssen.
Die internationale Markenklassifikation (auch Nizza-Klassifikation genannt) ist ein internationales Abkommen über die Einteilung von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung einer Marke. Sie wird von der WIPO verwaltet und weltweit in mehr als 140 Ländern genutzt. Mit der Markenklassifikation werden die beanspruchten Bereiche (Klassen) der Waren oder Dienstleistungen bestimmt, für die man sich einen Namen, ein Wort, Bild, Zeichen etc. schützen lassen kann. Sie besteht aus 45 Klassen.
Es ist möglich, dass sich verschiedene Anmelder dieselbe Wortmarke (z. B. Tempo) eintragen lassen, solange dies in unterschiedlichen Klassen geschieht. Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch unterschiedliche Klassen ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen enthalten können, so dass eine Eintragung ältere Rechte verletzen würde (z. B. Software in der Klasse 09 und Dienstleistungen eines Programmierers in der Klasse 42).
Es ist möglich, dass sich verschiedene Anmelder dieselbe Wortmarke (z. B. Tempo) eintragen lassen, solange dies in unterschiedlichen Klassen geschieht. Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch unterschiedliche Klassen ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen enthalten können, so dass eine Eintragung ältere Rechte verletzen würde (z. B. Software in der Klasse 09 und Dienstleistungen eines Programmierers in der Klasse 42).
Der Markeninhaber hat ein ausschließliches Recht an einer Marke. Durch einen Lizenzvertrag kann einem Dritten gestattet werden, das Zeichen zu nutzen.
Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung. Der Inhaber des Patents ist berechtigt, anderen die Nutzung der Erfindung zu untersagen. Das Schutzrecht wird auf Zeit gewährt; in Deutschland gemäß § 16 Patentgesetz für 20 Jahre.
Im deutschen Sprachraum wird der Begriff „Patent“ eindeutig für ein Schutzrecht auf eine technisch geprägte Erfindung verwendet. Im englischen Sprachraum kennt das US-Recht allerdings zwei Arten von Patenten, nämlich das utility patent und das design patent. Das utility patent ist ein Schutzrecht auf eine technische Erfindung, das design patent, im Englischen manchmal nur als design angesprochen, hingegen ein Schutzrecht auf Formen und Muster – eben auf ein Design.
Im deutschen Sprachraum wird der Begriff „Patent“ eindeutig für ein Schutzrecht auf eine technisch geprägte Erfindung verwendet. Im englischen Sprachraum kennt das US-Recht allerdings zwei Arten von Patenten, nämlich das utility patent und das design patent. Das utility patent ist ein Schutzrecht auf eine technische Erfindung, das design patent, im Englischen manchmal nur als design angesprochen, hingegen ein Schutzrecht auf Formen und Muster – eben auf ein Design.
Im Falle der Kollision von Markenrechten hat grundsätzlich die ältere Marke Vorrang. Das bedeutet, dass der Inhaber einer Marke, für die er als erster Schutz erlangt hat, andere daran hindern kann, ein identisches oder ähnliches Zeichen zu beanspruchen oder zu benutzen.
Als Produktpiraterie, Produktfälschung oder Markenpiraterie wird das Geschäft mit Nachahmer-Waren bezeichnet, die mit dem Ziel hergestellt werden, einer Original-Ware zum Verwechseln ähnlich zu sein. Dabei werden Markenrechte oder wettbewerbsrechtliche Vorschriften verletzt. Häufig geht die Produktpiraterie dabei auch mit Verletzungen von Urheberrechten, eingetragenen Designs (früher: Geschmacksmustern), Gebrauchsmustern, Patenten und sonstigen Rechten des Geistigen Eigentums und Gewerblichen Rechtsschutzes einher.
Gefälscht wird in allen Bereichen: Software, Uhren, Bekleidung, Medikamente, Autoteile bis hin zu kompletten Kraftfahrzeugen.
Auch Ersatzteile von Maschinen und Investitionsgütern – sogar von Flugzeugen – werden kopiert.
Maßnahmen gegen Produktpiraterie und Fälschungen beschreiben Produktschutz und Produktsicherung.
Gefälscht wird in allen Bereichen: Software, Uhren, Bekleidung, Medikamente, Autoteile bis hin zu kompletten Kraftfahrzeugen.
Auch Ersatzteile von Maschinen und Investitionsgütern – sogar von Flugzeugen – werden kopiert.
Maßnahmen gegen Produktpiraterie und Fälschungen beschreiben Produktschutz und Produktsicherung.
Unter Produktschutz, Produktsicherung oder Anti-Counterfeiting (engl. 'gegen das Fälschen') werden alle Maßnahmen verstanden, durch die ein Produkt gegen Produktpiraterie und Fälschungen geschützt werden kann. Der Begriff Produktschutz umfasst zudem auch Maßnahmen gegen die mutwillige Beeinträchtigung von Produkten, etwa von Lebensmitteln.
Verfolgte Ansätze sind rechtlicher, organisatorischer, wirtschaftlicher und technologischer Art. Ziel sämtlicher Ansätze ist es, das Fälschen von Produkten mit möglichst einfachen und billigen Mitteln so teuer zu machen, dass es sich für die Fälscher nicht mehr lohnt. Hierfür muss zwischen Erkennungsmerkmal und Sicherheitsmerkmal unterschieden werden. Erkennungsmerkmale sind beispielsweise Logos oder ein typisches Produktdesign. Sie grenzen ein Produkt gegenüber konkurrierenden Produkten ab. Solche Erkennungsmerkmale bieten aber keine Sicherheit, wenn es um Produktfälschungen geht. Anders verhält es sich beim Sicherheitsmerkmal, das beispielsweise ein Hologramm oder ein in das Produkt eingelassener Sicherheitsfaden sein kann.
Durch Produktschutz kann der kalkulierte Umsatz im Produktlebenszyklus erreicht werden, da Verluste wegen Produktpiraterie und Nachahmung verhindert werden. Er ergänzt die Strategien, geistiges Eigentum durch Schutzrechte (wie Patente, Marken) zu schützen und wirkt im Gegensatz zu diesen vorbeugend.
Verfolgte Ansätze sind rechtlicher, organisatorischer, wirtschaftlicher und technologischer Art. Ziel sämtlicher Ansätze ist es, das Fälschen von Produkten mit möglichst einfachen und billigen Mitteln so teuer zu machen, dass es sich für die Fälscher nicht mehr lohnt. Hierfür muss zwischen Erkennungsmerkmal und Sicherheitsmerkmal unterschieden werden. Erkennungsmerkmale sind beispielsweise Logos oder ein typisches Produktdesign. Sie grenzen ein Produkt gegenüber konkurrierenden Produkten ab. Solche Erkennungsmerkmale bieten aber keine Sicherheit, wenn es um Produktfälschungen geht. Anders verhält es sich beim Sicherheitsmerkmal, das beispielsweise ein Hologramm oder ein in das Produkt eingelassener Sicherheitsfaden sein kann.
Durch Produktschutz kann der kalkulierte Umsatz im Produktlebenszyklus erreicht werden, da Verluste wegen Produktpiraterie und Nachahmung verhindert werden. Er ergänzt die Strategien, geistiges Eigentum durch Schutzrechte (wie Patente, Marken) zu schützen und wirkt im Gegensatz zu diesen vorbeugend.
Absolute Schutzhindernisse sind der Sammelbegriff für zahlreiche gesetzliche Tatbestände, die der Eintragbarkeit eines Zeichens als Marke im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts entgegenstehen. Den Gegensatz hierzu bilden relative Schutzhindernisse, bei denen es sich um vorrangige Kennzeichenrechte und sonstige Rechte Dritter handelt.
Zu den absoluten Schutzhindernissen gehören das Fehlen jeglicher 'Unterscheidungskraft', z.B. die Produkte beschreibenden Angaben und Zeichen wie Dönermanufaktur, Frankfurt Card, Doublemint. Aber auch Werbeschlagwörtern allgemeiner Art wie Premium, Ultra und Mega.
Bier als Wortmarke könnte nicht für die Ware Bier als Marke eingetragen werden, da hier für die angesprochenen Verkehrskreise ein beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund steht. Hingegen könnte die Wortmarke Bier durchaus für Bekleidungsstücke Unterscheidungskraft aufweisen.
Diesel könnte für Kraftstoffe ebenfalls nicht eingetragen werden. Auch hier steht für das Publikum ein beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund. Auch hier kann Diesel für Bekleidungswaren durchaus eingetragen werden, da nicht anzunehmen ist, dass ein Bekleidungshersteller diesen Begriff zur Beschreibung eines Bekleidungsstückes benötigt.
Unter dem Sammelbegriff 'beschreibende Angaben' sind gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Zeichen oder Angaben zusammengefasst, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit (z.B. Power, Turbo) der Menge, der Bestimmung, des Wertes (günstig, preiswert) der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, z.B. Young Fashion, Frankfurter Magazin oder Best Price.
Für derartige beschreibende Angaben besteht grundsätzlich ein Freihaltebedürfnis der Marktteilnehmer.
Zu den absoluten Schutzhindernissen gehören das Fehlen jeglicher 'Unterscheidungskraft', z.B. die Produkte beschreibenden Angaben und Zeichen wie Dönermanufaktur, Frankfurt Card, Doublemint. Aber auch Werbeschlagwörtern allgemeiner Art wie Premium, Ultra und Mega.
Bier als Wortmarke könnte nicht für die Ware Bier als Marke eingetragen werden, da hier für die angesprochenen Verkehrskreise ein beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund steht. Hingegen könnte die Wortmarke Bier durchaus für Bekleidungsstücke Unterscheidungskraft aufweisen.
Diesel könnte für Kraftstoffe ebenfalls nicht eingetragen werden. Auch hier steht für das Publikum ein beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund. Auch hier kann Diesel für Bekleidungswaren durchaus eingetragen werden, da nicht anzunehmen ist, dass ein Bekleidungshersteller diesen Begriff zur Beschreibung eines Bekleidungsstückes benötigt.
Unter dem Sammelbegriff 'beschreibende Angaben' sind gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Zeichen oder Angaben zusammengefasst, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit (z.B. Power, Turbo) der Menge, der Bestimmung, des Wertes (günstig, preiswert) der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, z.B. Young Fashion, Frankfurter Magazin oder Best Price.
Für derartige beschreibende Angaben besteht grundsätzlich ein Freihaltebedürfnis der Marktteilnehmer.
Der Schutzumfang einer Marke setzt sich zusammen aus:
1. territorialem Schutzumfang (bei einer nationalen, beim DPMA eingetragenen Marke, das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland)
2. der Kennzeichnungskraft, also der Fähigkeit einer Marke vom Verbraucher wiedererkannt zu werden (eine Marke, die eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt, verfügt regelmäßig über einen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Schutzumfang)
3. der Anzahl der Waren und/oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen wurde.
1. territorialem Schutzumfang (bei einer nationalen, beim DPMA eingetragenen Marke, das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland)
2. der Kennzeichnungskraft, also der Fähigkeit einer Marke vom Verbraucher wiedererkannt zu werden (eine Marke, die eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt, verfügt regelmäßig über einen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Schutzumfang)
3. der Anzahl der Waren und/oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen wurde.
Die Unionsmarke (englisch European Union trade mark; bis 23. März 2016 Gemeinschaftsmarke) ist ein Rechtsinstitut des gewerblichen Rechtsschutzes auf der Ebene des europäischen Sekundärrechtes. Sie dient wie die nationale Marke dazu, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von anderen zu unterscheiden. Mit Eintragung einer Unionsmarke erlangt der Rechtsinhaber eine Rechtsposition innerhalb des gesamten Binnenmarktes der Europäischen Union.
Die Unionsmarke bietet den Vorteil eines einheitlichen Schutzes in allen Ländern der Europäischen Union. Erforderlich hierfür ist nur ein einziges Eintragungsverfahren beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO).
Die Unionsmarke bietet den Vorteil eines einheitlichen Schutzes in allen Ländern der Europäischen Union. Erforderlich hierfür ist nur ein einziges Eintragungsverfahren beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO).
Unterscheidungskraft ist die konkrete Eignung einer Marke, Waren oder Dienstleistungen des einen Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden und damit eine betriebliche Zuordnung der Waren bzw. Dienstleistungen zu ermöglichen.
Damit eine Marke in das Markenregister eingetragen werden kann, muss sie u. a. Unterscheidungskraft aufweisen. Im Gegensatz zur abstrakten Unterscheidungseignung wird hierbei auf die im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Marke beanspruchten Waren abgestellt. Aus der Formulierung im MarkenG (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) heraus lässt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des EuGH die Zurückweisung einer Markenanmeldung nur dann zu, wenn die Marke keinerlei Unterscheidungskraft aufweist, d.h. eine noch so kleine Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden.
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH weist eine Marke Unterscheidungskraft auf, wenn ihr kein im Vordergrund stehender, beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Maßgeblich ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise. Diese definiert der EuGH als den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen, verständigen Durchschnittsverbraucher.
Damit eine Marke in das Markenregister eingetragen werden kann, muss sie u. a. Unterscheidungskraft aufweisen. Im Gegensatz zur abstrakten Unterscheidungseignung wird hierbei auf die im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Marke beanspruchten Waren abgestellt. Aus der Formulierung im MarkenG (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) heraus lässt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des EuGH die Zurückweisung einer Markenanmeldung nur dann zu, wenn die Marke keinerlei Unterscheidungskraft aufweist, d.h. eine noch so kleine Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden.
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH weist eine Marke Unterscheidungskraft auf, wenn ihr kein im Vordergrund stehender, beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Maßgeblich ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise. Diese definiert der EuGH als den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen, verständigen Durchschnittsverbraucher.
Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet zehn Jahre danach. Wurde die Marke vor dem 14. Januar 2019 eingetragen, endet die zehnjährige Schutzdauer nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Sie können den Markenschutz immer wieder um jeweils zehn Jahre verlängern. Für eine vollständige Verlängerung Ihrer Marke genügt die Einzahlung der Verlängerungsgebühren. Soll die Marke dagegen nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen verlängert werden, müssen Sie dies zusätzlich mit dem Formular 'Verlängerung der Schutzdauer und Änderung des Schutzumfangs' des DPMA beantragen.
Die Verlängerungsgebühr für die folgende Schutzfrist ist sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer fällig und kann binnen sechs Monaten zuschlagsfrei gezahlt werden. Wird die Verlängerungsgebühr erst nach Ablauf der Schutzdauer gezahlt, sind innerhalb der sechsmonatigen Nachfrist neben der Verlängerungsgebühr auch Zuschlagsgebühren zu entrichten. Soll die Schutzdauer der Marke für mehr als drei Klassen verlängert werden, fallen zusätzlich Klassengebühren an. Das DPMA unterrichtet den Markeninhaber acht Monate im Voraus über den Ablauf der Schutzdauer, haftet aber nicht, wenn die Unterrichtung unterbleibt.
Verlängerungsgebühren dürfen frühestens sechs Monate vor Eintritt der Fälligkeit gezahlt werden. Werden die Verlängerungsgebühren nicht oder nicht ausreichend gezahlt, erlischt das Markenrecht.
Die Verlängerungsgebühr für die folgende Schutzfrist ist sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer fällig und kann binnen sechs Monaten zuschlagsfrei gezahlt werden. Wird die Verlängerungsgebühr erst nach Ablauf der Schutzdauer gezahlt, sind innerhalb der sechsmonatigen Nachfrist neben der Verlängerungsgebühr auch Zuschlagsgebühren zu entrichten. Soll die Schutzdauer der Marke für mehr als drei Klassen verlängert werden, fallen zusätzlich Klassengebühren an. Das DPMA unterrichtet den Markeninhaber acht Monate im Voraus über den Ablauf der Schutzdauer, haftet aber nicht, wenn die Unterrichtung unterbleibt.
Verlängerungsgebühren dürfen frühestens sechs Monate vor Eintritt der Fälligkeit gezahlt werden. Werden die Verlängerungsgebühren nicht oder nicht ausreichend gezahlt, erlischt das Markenrecht.
Verwechslungsgefahr bei Marken liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die Waren oder Dienstleistungen, die mit der jüngeren Marke gekennzeichnet sind, aus dem Unternehmen des Inhabers der älteren Marke stammen.
Alle neu eingetragenen Marken werden im Markenblatt des zuständigen Markenamts elektronisch veröffentlicht, der Veröffentlichungstag (VT) dokumentiert den Tag der Veröffentlichung der Eintragung.
Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist eine wichtige, unabdingbare Voraussetzung für die Eintragung einer Marke im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts. Der Schutzumfang einer eingetragenen Marke wird durch ihr zugehöriges Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bestimmt und abgegrenzt.
Daher ist es schon aus Gründen der Rechtssicherheit geboten, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig zu formulieren. Nur hierdurch ist eine Abgrenzung zu nicht beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und damit zu anderen in ihrer Form identischen oder ähnlichen Marken möglich.
Daher ist es schon aus Gründen der Rechtssicherheit geboten, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig zu formulieren. Nur hierdurch ist eine Abgrenzung zu nicht beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und damit zu anderen in ihrer Form identischen oder ähnlichen Marken möglich.
Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung einer Marke kann der Inhaber eines älteren Markenrechts oder einer Firmenbezeichnung gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erheben, wenn er sich in seinen Rechten verletzt fühlt.
Im Widerspruchsverfahren prüft das zuständige Markenamt, ob zwei sich gegenüberstehende Zeichen verwechselt werden könnten, hinsichtlich ihrer Bezeichnung und der jeweils geschützten Waren und Dienstleistungen. Ist dies der Fall, kann die neu eingetragene Marke ganz oder teilweise wieder aus dem Markenregister gelöscht werden.
Die Wiener Klassifikation ist eine Klassifikation zur international einheitlichen Erschließung der Bildbestandteile von Bild- und Wort-/Bildmarken. Dazu werden die Bildbestandteile in derzeit 29 Kategorien, 145 Abschnitte und 1.734 Unterabschnitte, bestehend aus 816 Hauptunterabschnitten und 918 Hilfsunterabschnitten, aufgeteilt. Zu den Unterzeichnern gehören derzeit 32 Staaten, verwendet wird sie jedoch von 39 Ländern, 3 Organisationen sowie der WIPO.
Nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) ist es möglich, eine Marke in ein internationales Register (IR) einzutragen. Der Antrag auf internationale Registrierung ist über das DPMA an die WIPO zu stellen und setzt eine deutsche Basismarke voraus.
Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (englisch World Intellectual Property Organization, WIPO) wurde am 14. Juli 1967 durch das Stockholmer Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum als Nachfolgerin des seit 1883 bestehenden Büros zum Schutz des geistigen Eigentums (BIRPI) mit dem Ziel gegründet, Rechte an immateriellen Gütern weltweit zu fördern. 1974 wurde die WIPO Teilorganisation der Vereinten Nationen, die Organisation hat ihren Sitz in Genf.
Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (englisch World Intellectual Property Organization, WIPO) wurde am 14. Juli 1967 durch das Stockholmer Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum als Nachfolgerin des seit 1883 bestehenden Büros zum Schutz des geistigen Eigentums (BIRPI) mit dem Ziel gegründet, Rechte an immateriellen Gütern weltweit zu fördern. 1974 wurde die WIPO Teilorganisation der Vereinten Nationen, die Organisation hat ihren Sitz in Genf.
Die Wortmarke ist eine Form der Marke, die aus Wörtern, Zahlen, Buchstaben oder weiteren Schriftzeichen besteht. Eine Wortmarke muss für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens eine konkrete Eignung gegenüber denen anderer Unternehmen besitzen, um als Unterscheidungsmittel zu gelten. Diese Unterscheidungskraft fehlt etwa bei rein beschreibenden Worten wie Limonade, extra oder hautaktiv.
Unter einer Wort-Bild-Marke versteht man eine dauerhafte Kombination zwischen textlichen und grafischen Elementen in einer Darstellung (z.B. Logo oder Emblem). Die Bezeichnung Wort-Bild-Marke erklärt sich aus der Kombination aus Text (Wort) und Grafik (Bild). Damit grenzt sie sich von Marken ab, die aus reinem Text bestehen (Wortmarke) oder aus reiner Grafik (Bildmarke). Grundsätzlich gilt, dass die Marke nicht mit einer handelsüblichen Schreibmaschine darstellbar sein darf, da sie sonst als Wortmarke gilt. Eine Grafik zu dem Text ist aber nicht zwingend erforderlich, solange die Schrift selbst grafische Merkmale aufweist (z. B. spezieller Font).
Wird einer Bildmarke vorübergehend Text hinzugefügt (z. B. im Rahmen von Aktionen, Jubiläen), liegt keine Wort-Bild-Marke vor. Erst wenn Wort und Bild regelmäßig zusammen verwendet werden oder durch das Corporate Design als zusammengehörig definiert werden, spricht man von einer Wort-Bild-Marke. Markenrechtlich betrachtet ist eine Wort-Bild-Marke ein Zeichen, das sowohl eine Buchstabenfolge als auch graphische Gestaltungselemente aufweist.
Im Gegensatz zur reinen Wortmarke können auf diese Weise auch Begriffe markenrechtlich geschützt werden, die als reine Wortmarken wegen mangelnder Unterscheidungskraft oder eines bestehenden Freihalteinteresses – beispielsweise beschreibende Begriffe – dem Markenschutz nicht zugänglich sind. Der entstehende Schutz erstreckt sich dabei jedoch nur auf die Gesamtheit der Marke, d. h. auf beide Bestandteile (Wort und Bild). Der grafische (Bild-)Anteil wird mit der Wiener Klassifikation beschrieben.
Wird einer Bildmarke vorübergehend Text hinzugefügt (z. B. im Rahmen von Aktionen, Jubiläen), liegt keine Wort-Bild-Marke vor. Erst wenn Wort und Bild regelmäßig zusammen verwendet werden oder durch das Corporate Design als zusammengehörig definiert werden, spricht man von einer Wort-Bild-Marke. Markenrechtlich betrachtet ist eine Wort-Bild-Marke ein Zeichen, das sowohl eine Buchstabenfolge als auch graphische Gestaltungselemente aufweist.
Im Gegensatz zur reinen Wortmarke können auf diese Weise auch Begriffe markenrechtlich geschützt werden, die als reine Wortmarken wegen mangelnder Unterscheidungskraft oder eines bestehenden Freihalteinteresses – beispielsweise beschreibende Begriffe – dem Markenschutz nicht zugänglich sind. Der entstehende Schutz erstreckt sich dabei jedoch nur auf die Gesamtheit der Marke, d. h. auf beide Bestandteile (Wort und Bild). Der grafische (Bild-)Anteil wird mit der Wiener Klassifikation beschrieben.